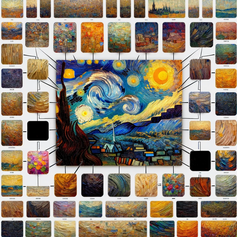Vergessene Schätze: 25 Jahre nach den Washingtoner Prinzipien – KI als Schlüssel zur Aufdeckung von NS-Raubkunst
Isabel Pieper
Vor 25 Jahren, im Dezember 1998, markierten die Washingtoner Prinzipien einen historischen Meilenstein im Kampf um die Rückgabe von Kunstwerken, die während des Nationalsozialismus geraubt wurden. Heute, ein Vierteljahrhundert später, steht die Provenienzforschung an der Schwelle einer neuen Ära, die geprägt ist durch die Einführung moderner Technologien wie der Künstlichen Intelligenz.
Diese Webseite führt Sie auf eine Reise durch die Welt der Provenienzforschung, beleuchtet durch das Prisma der KI. Entdecken Sie, wie innovative Technologien neue Wege in der Aufarbeitung dieser dunklen Vergangenheit eröffnen und einen Beitrag zur Rückführung verlorener Schätze leisten.
Herausforderungen der Provenienzforschung

In den dunklen Kapiteln der Geschichte Deutschlands hinterließ der Nationalsozialismus eine Spur der Verfolgung, der Zerstörung und des Diebstahls, die bis heute nachwirkt. Es wurden unzählige Werke geraubt und verschleppt, ein Vermächtnis, das die Provenienzforschung bis heute beschäftigt. Diese Disziplin, die sich mit der Herkunft und Geschichte von Kunstwerken befasst, steht seit jeher vor einer verantwortungsvollen Aufgabe.
Seit ihrem Entstehen hat sie sich gewandelt von einer Methode für die Reichen zur Sicherung ihrer Besitzansprüche hin zu einer Wissenschaft zur Herstellung von Gerechtigkeit und zur Aufklärung von im Dunklen liegenden Wegen der Kunst.
Die Identifizierung von Kunst, die während der NS-Zeit geraubt wurde, ist besonders herausfordernd. Hier spielen ethische, rechtliche und historische Aspekte eine entscheidende Rolle. Die Forscher müssen oft detektivisch vorgehen, um die oft bewusst verschleierten und im Wirbel der Zeit verlorenen Spuren der Herkunft zu entwirren. Jedes Kunstwerk erzählt eine eigene Geschichte – oft auch nach Jahrzehnten und über Generationen hinweg noch eine Geschichte des Verlusts und des Wunsches nach wiederhergestellter Gerechtigkeit.
Die Provenienzforschung ist zu vergleichen mit dem Zusammensetzen eines Puzzles, dessen Teile manchmal über Kontinente und Jahrzehnte verstreut sind. Die Digitalisierung hat die Arbeit in der Provenienzforschung verändert. Es kann nun schneller und effizienter mit Daten gearbeitet werden, aber es ergeben sich auch neue Fragen und Verantwortlichkeiten. Die Anwendung von KI in der Provenienzforschung eröffnet zukünftig Möglichkeiten, um die Herkunft von Kunstwerken effizienter und genauer zu bestimmen. Durch Technologien wie maschinelles Lernen und Bilderkennung können Muster in großen Datenmengen erkannt und klassifiziert werden. Dies kann es der Provenienzforschung ermöglichen, bisher verborgene Verbindungen aufzudecken und somit verlorene Werke ihren rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Die Herausforderung liegt darin, die Balance zwischen dem Potenzial von Künstlicher Intelligenz und dem Schutz sensibler Daten zu finden. Es muss verantwortungsvoll mit den Informationen umgegangen werden, die die Künstliche Intelligenz liefert.
KI in der Provenienzforschung
Die Anwendung der Künstlichen Intelligenz in der Provenienzforschung kann die Aufarbeitung der NS-Raubkunst in Geschwindigkeit und Effektivität befördern. KI-Technologien wie maschinelles Lernen, Bilderkennung und Datenanalysen bereichern methodische Ansätze wie beispielsweise die artistic provenance research, mit denen Forscher die Herkunft von Kunstwerken analysieren und interpretieren.
Durch den Einsatz von KI können große Datenmengen, die aus Archiven, Museen und privaten Sammlungen stammen, effizient analysiert werden. KI-Systeme sind in der Lage, zügig Muster und Verbindungen zu erkennen, die für menschliche Forscher bisher schwer zu erfassen waren. Diese Fähigkeit erweist sich als besonders wertvoll bei der Identifizierung von Kunstwerken, deren Herkunftsgeschichte unklar oder verloren gegangen ist.
Ein konkretes Beispiel für die Anwendung von KI in der Provenienzforschung ist das Projekt "Mapping Provenance" des Pratt Institute in New York. Dieses Studierenden-Projekt nutzt KI, um die Herkunft von Kunstwerken zu erforschen, die während der NS-Zeit geraubt wurden. Durch die Analyse von Auktionskatalogen und Archivmaterialien konnte das Projekt wichtige Informationen über die Herkunft und den Verbleib zahlreicher Kunstwerke gewinnen.
Künstliche Intelligenz eröffnet hierbei neue Perspektiven. Sie ermöglicht es, versteckte Spuren in der Geschichte der Kunstwerke zu entdecken und Licht in die dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit zu bringen.
Die Integration von KI in die Provenienzforschung vollzieht sich jedoch nicht ohne Herausforderungen. Es bedarf einer sorgfältigen Abwägung zwischen dem Potenzial der Technologie und dem Schutz sensibler Daten. Es muss sichergestellt sein, dass die KI nicht nur als Werkzeug zur Datenanalyse dient, sondern auch ethische Standards einhält. Es geht nicht nur um die Technologie an sich, sondern auch um die ethischen Implikationen ihres Einsatzes. So muss beispielsweise sichergestellt werden, dass die Privatsphäre und die Rechte von Betroffenen gewahrt bleiben.
Im Kontext des praktischen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz hat dies für Jana Noritsch, studierte Geschichts- und Kulturwissenschaftlerin mit 18-jähriger Erfahrung im Kunstmarkt und von Beruf Oeuvre- und Sammlungsforscherin, eine besondere Bedeutung bei der Zusammenarbeit zwischen menschlichen Experten und KI: "Die Kombination aus menschlicher Expertise und maschineller Wissensverarbeitung könnte unseren Umgang mit der Geschichte des Kunstmarktes grundlegend verändern. Es ist eine Partnerschaft, die sowohl die Effizienz als auch die Genauigkeit unserer Forschung erhöht, während sie gleichzeitig neue - auch ethische - Fragen aufwirft, die wir gemeinsam angehen müssen."
AI with a view: Die Analyse eines Kunstwerks
Eine Bilderreihe, die in groben Schritten zeigt, wie KI spezifische Merkmale eines Kunstwerks analysiert und interpretiert.
KI in Aktion: Fallbeispiele
Für die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Provenienzforschung und den daraus folgenden Möglichkeiten und aufgeworfenen Fragen nach der richtigen Balance zwischen technologischer Effizienz und ethischer Verantwortung gibt es konkrete Beispiele, die die heutige Anwendung und die Grenzen von KI in diesem Bereich beleuchten:
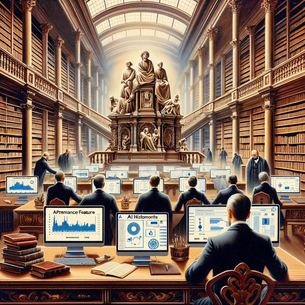
Die Österreichische Nationalbibliothek und ihre KI-gestützte Provenienzforschung
Hier wird KI verwendet, um Provenienzmerkmale in ihren Beständen zu identifizieren. Diese Technologie hat dazu beigetragen, die Herkunft einiger Werke zu klären, stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn es um die Interpretation komplexer historischer Kontexte geht. Während KI ein nützliches Werkzeug sein kann, ersetzt sie nicht die menschliche Expertise und die Notwendigkeit, historische Zusammenhänge tiefgehend zu verstehen.
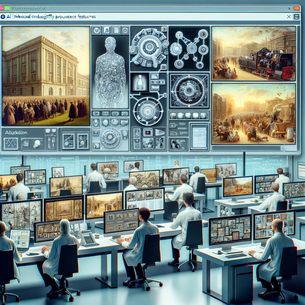
Das Fraunhofer-Institut und seine KI-basierten Bildsuchverfahren
Die innovativen Verfahren könne dazu beitragen, Provenienzmerkmale in historischen Bildaufnahmen zu identifizieren. Diese Methoden sind vielversprechend, erfordern jedoch eine sorgfältige Überwachung und Validierung durch Experten.
Technologien eröffnen Möglichkeiten in der Forschung, doch sie müssen verantwortungsvoll und mit einem kritischen Blick auf die Datenqualität eingesetzt werden.

Einsatz von KI in der Archäologie an der Goethe-Universität Frankfurt
An der Goethe-Universität Frankfurt wird Künstliche Intelligenz genutzt, um die Provenienz archäologischer Objekte zu untersuchen, die potentiell in Zeiten von Kolonialismus oder anderen Macht-Ausbeute-Strukturen geraubt wurden. Die KI-gestützte Analyse hilft dabei, die Herkunft dieser Objekte zu bestimmen, stößt aber auch auf Grenzen hinsichtlich der Interpretation und Nutzung kultureller Artefakte.
Ethik und KI: Ein Balanceakt
Künstliche Intelligenz in der Provenienzforschung öffnet nicht nur Türen zur Identifizierung und Rückführung von NS-Raubkunst, sondern wirft auch komplexe ethische Fragen auf. Diese reichen von Datenschutzbedenken bis hin zur Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis von KI-Erkenntnissen getroffen werden.
Es besteht daher die Notwendigkeit, ethische Richtlinien für den Einsatz von KI in der Provenienzforschung zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Technologie im Einklang mit moralischen und rechtlichen Standards verwendet wird.
Ein zentraler Aspekt ist der Schutz der Privatsphäre. Bei der Analyse von Kunstwerken und Dokumenten können persönliche Daten von ehemaligen Besitzern und ihren Nachkommen involviert sein. Die Herausforderung besteht darin, diese sensiblen Informationen zu schützen, während gleichzeitig die Herkunft der Kunstwerke aufgedeckt wird. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste diskutiert u.a. diese Thematik und bietet Einblicke in die Provenienzforschung.
Ein weiteres ethisches Dilemma betrifft die Verantwortlichkeit für Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden. Es ist wichtig, dass hinter jeder von einer Künstlichen Intelligenz unterstützten Entscheidung ein menschlicher Experte steht, der die Ergebnisse interpretiert und verantwortet. Die Frage der Verantwortlichkeit bei der Nutzung von KI in sensiblen Bereichen - wie der Provenienzforschung - wird daher auch in einem Bericht der Europäischen Kommission zu „Ethik-Richtlinien für vertrauenswürdige KI“ behandelt.
Die Entwicklung der Provenienzforschung wird auch von der Fähigkeit abhängen, die beschriebenen ethischen Herausforderungen zu meistern. Die Kombination aus menschlicher Expertise und maschineller Assistenz bietet eine vielversprechende Perspektive für die Aufarbeitung der Geschichte und die Rückführung von Kunstwerken. Doch dies erfordert ein Denken und Handeln, bei dem Ethik und Technologie Hand in Hand gehen, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen und Gerechtigkeit für die Opfer des Nationalsozialismus zu schaffen.

Die Zukunft der Provenienzforschung: Visionen und Realitäten
Die Provenienzforschung steht an der Schwelle einer neuen Ära. Technologische Entwicklungen wie der Einsatz Künstlicher Intelligenz eröffnen nicht nur Wege zur Aufdeckung und Rückführung von NS-Raubkunst, sondern stellen auch die Forschung vor neue Herausforderungen und Verantwortlichkeiten.
Die Zukunftsvision der Provenienzforschung mit KI klingt faszinierend: KI-Systeme, die riesige Datenmengen durchforsten, bislang verborgene Verbindungen aufdecken und verlorene Kunstwerke identifizieren und ihren rechtmäßigen Besitzern zuführen - solche Technologien können tatsächlich die Art und Weise, wie wir Kunstgeschichte betrachten und interpretieren, grundlegend verändern. Sie ermöglichen eine tiefere und umfassendere Analyse der Herkunft von Kunstwerken, die über das hinausgeht, was menschliche Forscher bis jetzt allein erreichen konnten.
Doch diese Vision existiert nicht ohne gegenüberstehende Realitäten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Daten, die Entwicklung ethischer Richtlinien und die Transparenz der Entscheidungsprozesse sind unumgänglich für einen Erfolg. Datenschutz und Anonymisierung von Daten, strenge Zugriffskontrollen und die Entwicklung von KI-Modellen, die ihre Analysemethoden offenlegen, sind nur einige der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um eine berechtigte Akzeptanz für so geschaffene Ergebnisse herzustellen.
Bei der Entwicklung ethischer Richtlinien für den Einsatz von KI in der Provenienzforschung sind sowohl die technischen Aspekte als auch die moralischen und historischen Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen. Sie könnten beispielsweise Vorgaben zur Datenverarbeitung, zur Transparenz der Algorithmen und zum Umgang mit den Ergebnissen der Analysen enthalten.
In der Zukunft der Provenienzforschung wird also eine enge Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Disziplinen, nämlich zwischen Technologen, Historikern und Ethikern erforderlich sein. Gemeinsam können sie sicherstellen, dass die KI nicht nur ein leistungsfähiges Werkzeug in der Aufdeckung von NS-Raubkunst ist, sondern auch ein Instrument, das mit Respekt und Verantwortung gegenüber der Geschichte eingesetzt wird.
Provenienzforschung im digitalen Zeitalter: Chancen und Verantwortung
Das 25-jährige Jubiläum der Washingtoner Prinzipien ist nicht nur ein Moment des Rückblicks, sondern auch ein Sprungbrett in die Zukunft der Provenienzforschung. Mit dem Einzug der Künstlichen Intelligenz in diesen Bereich wird Neuland betreten, das sowohl vielversprechende Möglichkeiten verspricht, indem sie die Identifizierung und Rückführung von NS-Raubkunst effizienter und genauer macht. Sondern sie erfordert auch ernsthafte ethische Überlegungen, denn mit dieser neuen Macht kommt auch eine neue Verantwortung. Ein sorgfältiger Umgang mit sensiblen Daten und die Wahrung der historischen Integrität sind unerlässlich.
Die Zukunft der Provenienzforschung wird geprägt sein von der Herausforderung, innovative Technologien verantwortungsvoll zu nutzen und gleichzeitig ethische Standards zu wahren. Die Washingtoner Prinzipien haben den Weg für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung geebnet. Es liegt nun an uns, diesen Weg mit Umsicht und Respekt fortzusetzen, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und das kulturelle Erbe für kommende Generationen zu sichern.
Ressourcen und weiterführende Informationen
Quellen
- https://kulturgutverluste.de/
- https://www.onb.ac.at/mehr/blogs/detail/machine-learning-fuer-die-provenienzerschliessung
- https://www.metmuseum.org/about-the-met/provenance-research-resources/monuments-men#:~:text=Representing%20thirteen%20nations%2C%20345%20men,for%20works%20of%20art%20subject
- https://www.pratt.edu/news/mapping-the-recovery-of-nazi-looted-artworks/
- https://studentwork.prattsi.org/mapping-provenance/
- https://www.youtube.com/watch?v=8pB8wtlHB34
- https://www.lostart.de/de/start
- https://lootedart.com/
- https://www.youtube.com/watch?v=-T6iGjGP_MU
- https://retour.hypotheses.org/2916#sdfootnote55sym
- DALL·E 3, OpenAI
- GPT-4, OpenAI
Semesterergebnisse der Seminare »KI & Ethik« und »Neue KI-gestützte Arbeits- und Organisationsformen« der Masterstudiengänge im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel